 Schon in aller Frühe sitze ich mit dem Besitzer des Hostels Canny unter einem Baum im Garten und er erzählt von der Zeit rund um Katrina. Er ist in dieser Gegend aufgewachsen: „Während Katrina war ich bei meiner Schwester in Baton Rouge. Nach zwei Wochen sind wir mit einem einfachen Boot zum Hostel gekommen. Das Wasser stand zwei Meter hoch. Im Wasser war alles drinnen, vom Öl bis zu den Kühlflüssigkeiten bis hin zu den toten Tieren. Wir nannten diese Brühe „doxische Suppe“. Unvorstellbar. Nach drei Wochen hat sich der Wasserspiegel langsam zu senken begonnen, ganz langsam. Zwei Tage für 10 cm. Nach drei Wochen war das Haus „wasserfrei“. Wir haben sofort begonnen alles zu richten und zu reparieren. Es gab aber keinen Strom und jede Infrastruktur fehlte. Trotzdem. Wir haben zusammengeholfen. Es war unbeschreiblich: keine Vögel, keine Tiere, keine Autos, unglaubliche Stille, kein Licht in der Nacht, monatelang keine Kinder – Totenstille.
Schon in aller Frühe sitze ich mit dem Besitzer des Hostels Canny unter einem Baum im Garten und er erzählt von der Zeit rund um Katrina. Er ist in dieser Gegend aufgewachsen: „Während Katrina war ich bei meiner Schwester in Baton Rouge. Nach zwei Wochen sind wir mit einem einfachen Boot zum Hostel gekommen. Das Wasser stand zwei Meter hoch. Im Wasser war alles drinnen, vom Öl bis zu den Kühlflüssigkeiten bis hin zu den toten Tieren. Wir nannten diese Brühe „doxische Suppe“. Unvorstellbar. Nach drei Wochen hat sich der Wasserspiegel langsam zu senken begonnen, ganz langsam. Zwei Tage für 10 cm. Nach drei Wochen war das Haus „wasserfrei“. Wir haben sofort begonnen alles zu richten und zu reparieren. Es gab aber keinen Strom und jede Infrastruktur fehlte. Trotzdem. Wir haben zusammengeholfen. Es war unbeschreiblich: keine Vögel, keine Tiere, keine Autos, unglaubliche Stille, kein Licht in der Nacht, monatelang keine Kinder – Totenstille.  Es war die radikalste Reflexion meines Lebens.“ Mitte Dezember (Katrina: 29. Aug) kam der Strom. Eröffnet wurde auf einfachster Basis zu Weihnachten 2005.
Es war die radikalste Reflexion meines Lebens.“ Mitte Dezember (Katrina: 29. Aug) kam der Strom. Eröffnet wurde auf einfachster Basis zu Weihnachten 2005.
Wir haben einen Plan. No, it’s our city
Canny spricht darüber, dass in New Orleans keine Amerikaner leben. Es ist die Mischung aus den verschiedensten Völkern der ganzen Welt, “die immer wieder hier gelandet sind.“ Nach Katrina wären die Amerikaner gekommen und hätten die Stadt gekauft. Sie haben gemeint: Wir haben einen Plan und bauen die Stadt neu auf. Es kam ein großes Nein. Diese Hilfe und Einmischung wurde so weit wie möglich draußen gehalten. New Orleans ist anders und muss anders bleiben. Ich denke dass hier wenig bis kein Zentralismus ist. Hier wird nicht übereinander geherrscht. Die Leute gestalten seit Jahrhinderten in diesem Delta sehr beweglich und angepasst auf Augenhöhe ihr Leben. Die Hochhäuser passen gar nicht in dieses Delta, weil sie den Eindruck erwecken, in einem Delta der dauernden Bewegung, Veränderung, Bedrohung, Überschwemmung etwas fix für Jahrhunderte errichten könnten.  Der Mississippi hat im Laufe der Jahrtausenden 7 Ausflüsse (und damit Deltas) ins Meer gesucht und gefunden. Was wird in 2000 Jahren sein? Ist er endgültig gezähmt? Nein. Den Menschen ist das „kein Problem“, weil sie von ihrer grundsätzlichen Einstellung auf Bewegung und gegenseitige Hilfe (neighborhood) „programmiert“ sind. Jedes Dogma kann da lebensbedrohlich werden. Es ist unglaublich und berührend, die Geschichte dieser Stadt zu studieren und zu sehen, wie das heute noch funktioniert. Diese Stimmung ist schwer zu beschreiben.
Der Mississippi hat im Laufe der Jahrtausenden 7 Ausflüsse (und damit Deltas) ins Meer gesucht und gefunden. Was wird in 2000 Jahren sein? Ist er endgültig gezähmt? Nein. Den Menschen ist das „kein Problem“, weil sie von ihrer grundsätzlichen Einstellung auf Bewegung und gegenseitige Hilfe (neighborhood) „programmiert“ sind. Jedes Dogma kann da lebensbedrohlich werden. Es ist unglaublich und berührend, die Geschichte dieser Stadt zu studieren und zu sehen, wie das heute noch funktioniert. Diese Stimmung ist schwer zu beschreiben.
Das „Delta-Denken und Handeln“ könnte viel lösen
 Das Gespräch mit Canny, der Besuch des Nationalparkcenters und das lange Sitzen am Mississippi verleiten mich zu einer weiteren Reflexion über die römische und katholische Kirche, aber genauso über die Politik. Auslöser war Canny. Er ist katholisch aufgewachsen und hat sich von dieser Kirche verabschiedet. Die r.k. ist die „predominated church“ (vorherrschende) hier in New Orleans. „Es darf keine Maus einen Furz machen, den nicht der Erzbischof wissen muss“, schmunzelt Canny und sagt, dass sich dieses predominated zum Negativen gewandelt hat. War früher das Katholische im Sinne von verbindender Faden über alle Kulturen und Spiritualitäten hinweg im Vordergrund. Heute wird abgeschottet und die Vorherrschaft „gezeigt“. Viele Würdenträger treten überheblich auf, weil sie noch alte „Machtinstrumente“ glauben zu haben. Die Leute finden das lächerlich. Gegenüber der Straße ist eine große Kirche nicht mehr in Betrieb genommen worden, nicht mehr das Kloster und nicht mehr die Schule. „It’s a shame“, sagt mir ein Passant, den ich frage, warum die Kirche geschlossen ist. „Es geht ihnen das Geld aus, weil die Leute reserviert sind“, meint Canny. Ich spüre bei meinen Kirchenbesuchen auch: Das Leben ist hier ausgezogen und von Rom und den Konservativen wird der Druck noch erhöht, der die Verantwortlichen ins Ghetto treibt. Ich denke:
Das Gespräch mit Canny, der Besuch des Nationalparkcenters und das lange Sitzen am Mississippi verleiten mich zu einer weiteren Reflexion über die römische und katholische Kirche, aber genauso über die Politik. Auslöser war Canny. Er ist katholisch aufgewachsen und hat sich von dieser Kirche verabschiedet. Die r.k. ist die „predominated church“ (vorherrschende) hier in New Orleans. „Es darf keine Maus einen Furz machen, den nicht der Erzbischof wissen muss“, schmunzelt Canny und sagt, dass sich dieses predominated zum Negativen gewandelt hat. War früher das Katholische im Sinne von verbindender Faden über alle Kulturen und Spiritualitäten hinweg im Vordergrund. Heute wird abgeschottet und die Vorherrschaft „gezeigt“. Viele Würdenträger treten überheblich auf, weil sie noch alte „Machtinstrumente“ glauben zu haben. Die Leute finden das lächerlich. Gegenüber der Straße ist eine große Kirche nicht mehr in Betrieb genommen worden, nicht mehr das Kloster und nicht mehr die Schule. „It’s a shame“, sagt mir ein Passant, den ich frage, warum die Kirche geschlossen ist. „Es geht ihnen das Geld aus, weil die Leute reserviert sind“, meint Canny. Ich spüre bei meinen Kirchenbesuchen auch: Das Leben ist hier ausgezogen und von Rom und den Konservativen wird der Druck noch erhöht, der die Verantwortlichen ins Ghetto treibt. Ich denke:  Wenn der Vatikan glaubt, dass die Probleme nur in Mitteleuropa sind, dann wagen sie keinen Blick in die Realität, die sich in diesem bewegten und bewegenden Mississippi-Delta abspielt. Die Amtskirche ist auch hier dabei, die Menschen aus dem Auge zu verlieren.
Wenn der Vatikan glaubt, dass die Probleme nur in Mitteleuropa sind, dann wagen sie keinen Blick in die Realität, die sich in diesem bewegten und bewegenden Mississippi-Delta abspielt. Die Amtskirche ist auch hier dabei, die Menschen aus dem Auge zu verlieren.
Das Delta heißt immer“ Aggiornamento“ oder untergehen
Das Mississippi-Delta ist das Gebiet zwischen dem Meer und dem Festland – immer noch in Bewegung. Die sich hier ansiedelnden Menschen haben das über die Jahrhunderte beachtet und einen unglaublichen Lebenswillen, Zusammenhalt, Kultur, Musik gelebt – und alles in großer und respektvoller „Diversität“. 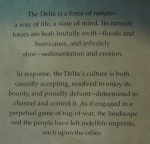 Vielfalt war der Schlüssel zum Überleben und nicht die Bedrohung. Monokultur geht nicht. Siedlungen haben sich immer verschoben. Hier konnte man nicht wirklich ein „sesshaftes Leben“ führen. „The big easy“ (so wird das Gefühl der Stadt beschrieben) können wir uns aus dieser Beweglichkeit der Bedrohungen gegenüber vorstellen. Es ist ein ständiges Ringen mit dem Wasser und dem gewonnen Land. Jede Kultur bereichert die andere und bringt neue Ideen, auch Feste, die gefeiert werden. Die Kirche hat damals selbst mit dem Voodoo-Ritualen Frieden geschlossen. Das nenne ich katholisch, wie es auch das Vatikanum II ausfaltet mit den Aggiornamento. Jesus hat ja kein neues System errichtet, sondern das Aggiornamento zum Heil, zum ganzen würdevollen Leben angestiftet. Wir sind befreit von Herrschaft. So kann der Jesus-Glaube, der befreit und zur Gemeinschaft führt, der innere Faden sein für diese Gegend. Heute merke ich an: könnte! Der Mensch wird heute so viel und oft verzweckt, vor allem von der Wirtschaft und den Medien. Hier sollte die Kirche nicht Moralapostel sein, sondern die Menschen zu einem eigenständigen, selbstbewussten und solidarischen Leben in Verantwortung ermutigen, anregen.
Vielfalt war der Schlüssel zum Überleben und nicht die Bedrohung. Monokultur geht nicht. Siedlungen haben sich immer verschoben. Hier konnte man nicht wirklich ein „sesshaftes Leben“ führen. „The big easy“ (so wird das Gefühl der Stadt beschrieben) können wir uns aus dieser Beweglichkeit der Bedrohungen gegenüber vorstellen. Es ist ein ständiges Ringen mit dem Wasser und dem gewonnen Land. Jede Kultur bereichert die andere und bringt neue Ideen, auch Feste, die gefeiert werden. Die Kirche hat damals selbst mit dem Voodoo-Ritualen Frieden geschlossen. Das nenne ich katholisch, wie es auch das Vatikanum II ausfaltet mit den Aggiornamento. Jesus hat ja kein neues System errichtet, sondern das Aggiornamento zum Heil, zum ganzen würdevollen Leben angestiftet. Wir sind befreit von Herrschaft. So kann der Jesus-Glaube, der befreit und zur Gemeinschaft führt, der innere Faden sein für diese Gegend. Heute merke ich an: könnte! Der Mensch wird heute so viel und oft verzweckt, vor allem von der Wirtschaft und den Medien. Hier sollte die Kirche nicht Moralapostel sein, sondern die Menschen zu einem eigenständigen, selbstbewussten und solidarischen Leben in Verantwortung ermutigen, anregen.  Vom Ich zum Wir. Ich lade die kirchlich Verantwortlichen wieder einmal ein (so wie in der Po-Ebene), 3 Wochen „inkognito“ hier zu leben. Sie könnten so viel Lebensfreude, Gemeinschaft und Glauben lernen. Vielfalt, Musik und die vielen Künste weisen uns hier schon ein Stück Himmel. Es ist unglaublich.
Vom Ich zum Wir. Ich lade die kirchlich Verantwortlichen wieder einmal ein (so wie in der Po-Ebene), 3 Wochen „inkognito“ hier zu leben. Sie könnten so viel Lebensfreude, Gemeinschaft und Glauben lernen. Vielfalt, Musik und die vielen Künste weisen uns hier schon ein Stück Himmel. Es ist unglaublich.
Ein noch radikalerer Gedanke: Der Vatikan sollte hierher ins Mississippi-Delta übersiedeln. Dann würde, ja müsste vieles beweglicher werden und es wäre wahrscheinlich auch vieles „lustiger“. Todernste Menschen habe ich hier noch keine getroffen – wohl aber in Rom.
 Man spricht hier vom „Delta-Cooking“. Es bräuchte mehr von der Sorte: Delta-Glauben, Delta-Pilitik, Delta-Wirtschaft.
Man spricht hier vom „Delta-Cooking“. Es bräuchte mehr von der Sorte: Delta-Glauben, Delta-Pilitik, Delta-Wirtschaft.
Außerdem verstehe ich von hier aus nicht (weil ich es im Internet lese), wie man die Schuldenbremse in der Verfassung aufnehmen will. Politiker und -innen sollten doch in der Delta-Welt entscheiden, was zu tun ist. Ja glaubt denn gar einer von denen, dass der Mississippi jetzt von der Verfassung gezähmt ist oder gar die Hurricans. Es ist zu tun, was zu tun ist, damit die Menschen zwischen Meer und Festland leben können. Und da sollte endlich die Finanzwelt auch in Bewegung kommen und alle Transaktionen für das Leben des Gemeinwohls im Delta besteuern. Gestern wäre besser als morgen.












































 Das Anpacken-Buch
Das Anpacken-Buch